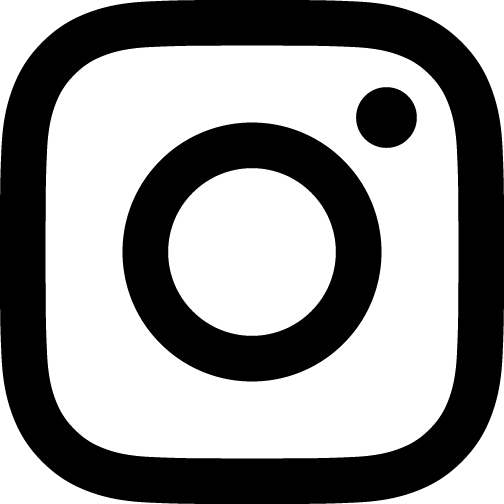Film des Jahres: 2017

Seit mehr als 60 Jahren vergibt die Evangelische Filmjury das Prädikat FILM DES MONATS an einen aktuell im Kino gestarteten Film. Aus den 2017 ausgezeichneten Filmen wählte sie den FILM DES JAHRES: das Drama „Moonlight“ von Barry Jenkins. Der Film erzählt in drei Kapiteln die Entwicklung eines schwarzen Schwulen aus Miami von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter, der mit der Vernachlässigung durch eine drogenabhängige Mutter, Ausgrenzung und Gewalt aufwächst.
Die Preisverleihung findet am Samstag, den 16. Dezember, 20.15 Uhr, im Kino des Deutschen Filmmuseums in Frankfurt am Main statt. In einer Laudautio wird die Filmkritikerin Verena Lueken, Redakteurin der FAZ, den Film würdigen. Mit dem undotierten Preis geehrt wird der Verleih des Films, DCM. Nach der Vorführung des Films findet ein Sektempfang statt.
In der Begründung der Evangelischen Filmjury für ihre Auszeichnung heißt es: „Was es heißt, anders als die Mehrheit zu empfinden und in einem von Gewalt geprägten Milieu sich behaupten zu müssen, macht der Film in einer geschickten Mischung von dramatischen und emotionalen Momenten deutlich. Der im Original glänzend getroffene Jargon, die Körperlichkeit der Darstellung und eine bewegliche, wechselnde Perspektiven eröffnende Kamera verleihen der Persönlichkeit der Hauptfigur plastisches Profil. Entstanden ist dabei das sensible Porträt eines Menschen und seiner sozialen Welt, die Diskriminierung und Marginalisierung ausgesetzt sind und sich selbst überlassen bleiben. Der Film nimmt ihre Würde ernst und sensibilisiert für die Eigenart und Verletzlichkeit jedes einzelnen.“
„Moonlight“ wurde bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, so mit dem Oscar 2017 der American Academy for Motion Pictures Arts and Sciences für den Besten Film und mit dem Golden Globe 2017 für den Besten Spielfilm.
"Moonlight" von Barry Jenkins
Laudatio zur Preisverleihung. Von Verena Lueken
Alle paar Jahre, wenn wir großes Glück haben, kommt ein Film in die Kinos, der eine Welt erleuchtet, die vorher unsichtbar war. Der Menschen zeichnet, Menschen aus Fleisch und Blut und mit Seelen voller Trauer, voller Sehnsucht, voller Liebe, von denen wir keine Ahnung hatten, weil sie mit den Figuren in den Filmen, die sonst ins Kino kommen, nicht verwandt sind.
Ein solcher Film ist „Moonlight“ von Barry Jenkins. Ein unabhängig produzierter Film aus Amerika. Ein hochdekorierter Film, Oscar-Gewinner des letzten Jahres – was oft gar nichts heißt, und in diesem Fall nur: ein Glücksfall, eine weise Entscheidung. Was nicht nur für die Oscar-Academy gilt, sondern, wenn ich mir das erlauben darf zu sagen, auch für die Jury der Evangelischen Filmarbeit, die „Moonlight“ zu ihrem Film des Jahres gewählt hat.
Wer sind diese Menschen, von denen wir nichts wissen? Deren Welt uns dieser Film ein Stück weit aufschließt?
Es geht um einen Jungen in Miami, der gehänselt wird, weil die anderen Jungen spüren, er ist anders. Seine Mutter ist cracksüchtig. Bei ihrem Dealer und seiner Freundin findet der Junge vorübergehend eine Ersatzfamilie. Der Junge, den die anderen und auch seine Mutter (aber nicht der Dealer und seine Freundin) „Little“ nennen, heißt Chiron. Der Film begleitet ihn beim Erwachsenwerden.
Schwarz sein in Amerika - das ist kein glamouröses Thema - nie gewesen. In Filmen kam es lange kaum vor, schwarze Menschen traten selten auf, es sei denn als Jazz-Combo im Hintergrund, Kellner oder Drogendealer. Das ändert sich gerade. Wir erleben ja aus ganz anderen Gründen in diesen Wochen einen gewaltigen Umsturz in der Unterhaltungsindustrie, und in vielen Firmen werden eine Menge Stellen frei. Auch wenn das noch nichts mit dem inhärenten Rassismus des Systems, sondern zunächst mit seinem offensichtlichen Sexismus zu tun hat, habe ich das Gefühl, die Lage wird sich dramatisch ändern – für Farbige, die immerhin 30 Prozent der amerikanischen Bevölkerung ausmachen, wie für Frauen.
Barry Jenkins hat mit „Moonlight“ jedenfalls ein grandioses Zeichen gesetzt. Der Film kam im vergangenen Jahr in dem Augenblick in die Welt, in der Amerikas Filmindustrie sich selbst eine größere Diversität verordnete, was vor allem bedeutete: Augen auf! An die Ränder schauen. Denn es ist ja nicht so, das es früher überhaupt keine Filme über das Leben der Schwarzen in den Vereinigten Staaten gegeben hätte. Aber sie blieben Randerscheinungen, meistens übersehen.
Das begann sich zu ändern, als der englische Künstler Steve McQueen mit „12 Years a Slave“ auf den Plan trat. Er gewann den Oscar für den besten Film 2014. Und dann Barry Jenkins mit dem Oscar als bester Film für „Moonlight“ 2016 (wir erinnern uns an die absurde Verwechselung bei der Preisverleihung).
Für die Zukunft bedeutet das hoffentlich: bessere Angebote, bessere Arbeitsbedingungen. Für Barry Jenkins ist die Folge zum Beispiel – eine Fernsehserie! (heute der Ritter) Das wird, vermute ich, eine grandiose Sache werden, es geht nämlich um die Verfilmung von „Underground Railraod“ von Colson Whitehead, seinen fantastischen Roman um die Geschichte einer fliehenden Sklavin, für die Whitehead seinerseits den Pulitzer Prize und den National Book Award und zig andere Auszeichnungen gewonnen hat. Es sieht also so aus, als sei das starre System der Unterhaltungsindustrie ganz schön in Bewegung geraten – während sich draußen im Land gleichzeitig Verfechter einer rassistischen weißen Vorherrschaft zum Gefecht, vielleicht zum letzten Gefecht rüsten.
„Moonlight“ also. Ein Film für alle, die endlich aufwachen wollen. Der Film eines schwarzen Regisseurs nach dem Stück eines schwarzen Autors, Tarell Alvin McCraney. Beide jünger als vierzig. Der Film über einen schwarzen Jungen in einer schwarzen Gegend Miamis, der zu sich und zu seiner Sexualität findet. Queer, ungewöhnlich erzählt, zum Heulen und wunderbar.
„Moonlight“ ist aber auch ein Film darüber, wie ein Freund einem anderen ein Abendessen kocht. Wie eine Mutter um Verzeihung bittet. Wie zwei Jungs am Strand für eine Stunde glücklich sind. Ein Film darüber, wie sich Männlichkeit in verschiedenen Situationen definiert, welche Möglichkeiten, welche Vorbilder ein Junge wie Chiron findet. Wie gesagt, Sie werden vermutlich am Ende weinen.
Am Anfang des Films ist Chiron - bzw „Little“ - acht Jahre alt. Ein stiller Junge mit riesigen Augen, kleiner als die anderen, allein. Vater? Fehlanzeige. Die Mutter meistens high, manchmal mit einem Mann, zwischendrin mal lieb, besorgt, oft verärgert, aber meistens abwesend. In der Schule Hänseleien. Ein Freund, der einzige Freund, Kevin, zeigt ihm, wie er sich wehren kann. Steh auf, sagt er. Aber auch: Bleib unten, wenn du genug hast. Diesen „Little“ spielt Alex Hibbert. Seine Augen drücken die Neugierde wie die Verletzlichkeit aus, und seine Körpersprache erzählt schon im Kern alles, was ihm im späteren Leben, wenn andere Schauspieler seine Rolle übernehmen, zustoßen mag, und wer er werden wird – ein einsamer Junge voller Sehnsucht, der lernen wird, sich zu behaupten.
Es passiert nicht so oft, dass wir im Kino Menschen sehen, die mit derart komplexen Gefühlen und Möglichkeiten ausgestattet waren, in allem, wozu Menschen fähig sind, im Guten eher als im Schlechten, und unter Umständen trotzdem süchtig sind und trotzdem dealen. Die Figuren in diesem Film passen sich den Verhältnissen an oder stellen sich ihnen entgegen, auf jeden Fall aber weigern sie sich zu werden, was die Welt von ihnen erwartet – nämlich rundherum böse, hinterhältig und gewalttätig (wie es unserem Klischee vom Jungen aus den Slums entspricht, wenn sie keine Genies werden, wie James Baldwin. Oder Barry Jenkins...).
Das bedeutet nicht, dass sie nicht unter Umständen kriminell seien. Eine Waffe zur Hand haben, wenn es nötig ist, eine goldene Zahnschiene und jede Menge Tätowierungen. Es bedeutet nur, sie sind verwundete, verwundbare Seelen. Keine Abziehbilder. Keine Klischees. Ihre Lebensumstände sind, wie sie sind.
Chiron läuft mit seinem riesigen Rucksack durch eine triste Sozialbausiedlung und kann von Glück sagen, wenn er unbehelligt nach Hause kommt. Das ist ein Bild, das bleibt. Ein Junge mit großen Augen, allein unter der Sonne Floridas.
Er braucht einen Vater, denkt man. Juan übernimmt diese Rolle vorübergehend. Ein harter Kerl, mit aufgepumpten Muskeln, bewaffnet. Aber auch ein fürsorglicher, zarter Mann, gefährlich und weich und väterlich. Er wird von Mahershala Ali gespielt. Er hat zu Recht mehr Auszeichnungen, darunter einen Oscar, bekommen, als ich hier aufzählen mag. Und im Anschluss endlich große Hauptrollen, darunter in der nächsten Staffel der Fernsehserie „True Detektives“.
Im zweiten Teil spielt Ashton Sanders den Teenager Chiron. Wieder sehen wir ihn, während die Kamera sich an seinen Rücken heftet, durch sein Viertel gehen, wieder sehen wir, wie er angegriffen, gehänselt wird, wie er den Kopf senkt und versucht, dem Streit aus dem Weg zu gehen. Eines Tages wehrt er sich und wird ein anderer. Nämlich der, als dem wir ihm im dritten Teil, gespielt diesmal von Trevante Rhodes, wiederbegegnen.
Barry Jenkins und Tarell Alvin McCraney, auf dessen Theaterstück „In Moonlight Black Boys Look Blue“ das Drehbuch basiert, sind in Miami aufgewachsen. Etwa zur selben Zeit, nämlich in den Achtzigern und Neunzigern, also auf dem Höhepunkt der Crack-Epidemie. Sie stammen beide ungefähr aus der Gegend, in der „Moonlight“ zunächst spielt (kannten sich aber vorher nicht).
Liberty City heißt der Wohnbezirk nicht ohne Ironie, und er hat nichts mit dem Art-Déco-Pomp von South Beach zu tun, den wir mit Miami verbinden.
Hier sind die Menschen arm, hier liegen brache Flächen zwischen den niedrigen Häuserreihen, hier sind Banden zu Hause, die Polizei schaut eher selten mal vorbei. Aber es gibt eine Gemeinschaft unter den Bewohnern, eine gewisse Fürsorge füreinander, den Versuch, vieles, was schlecht läuft für Schwarze in Amerika auszugleichen. Die Väter sind im Gefängnis? Die Nachbarn übernehmen, auch, wenn einer von ihnen Drogen verkauft. Das ist, so erzählen es die beiden in Interviews, eine der Regeln in schwarzen Communities: dass man sich um die Kinder kümmert, um die eigenen, aber auch um die, deren Eltern anderswo sind, im Knast oder bei der Arbeit, high oder noch bei einem zweiten oder dritten Job.
Das ist keine romantische Sicht auf eine verheerende Situation, sondern Notwehr. Dass Kinder dabei oft auch missbraucht werden, für Drogenkurierdienste in der Schule zum Beispiel, ist sicher eine traurige Tatsache. In „Moonlight“, wenn beim Zuschauer diese Furcht aufkommt, läuft es anders. Sie werden die wunderbare Janelle Monáe sehen, einen Star in der Rhythm `n`Blues-Szene, und hören, wie sie den ebenfalls wunderbaren Satz sagt: „All Love and Pride in My House“ wenn es eigentlich nach etwas ganz anderem aussieht.
Apropos hören: „Moonlight“ hat einen außergewöhnlichen Soundtrack. Es geht los mit einem Remix von „Every Nigger is a Star“ in der ersten Einstellung, es kommt Mozart hinzu und ein fast klassischer Soundtrack von Nicholas Britell bis zum Hip-Hop im letzten Akt, „southern hip-hop“, um genau zu sein, „chopped and screwed“, was soviel bedeutet wie: extrem verlangsamt und immer mehr Macht den Bässen.
Jeder dieser Stile scheint tief im Inneren der Figuren widerzuhallen. Wie auch das Licht, das dem letztlich dem Neorealismus verpflichteten Ansatz dieses Films einen Zug ins Fieberhafte, Traumhafte verleiht.
Und noch etwas werden Sie sehen: Leuchtende Körper. Glänzende Haut. Ich hatte das Glück, Barry Jenkins zu treffen, bevor der Trubel um Golden Globes und Oscars losging, vor einem Jahr etwa. Und er erzählte in diesem Gespräch, wie wichtig es ihm gewesen sei, dass die Hautfarbe der Menschen in seinem Film tief leuchtet und die Körper plastisch wirken. Er hat mit seinem Kameramann James Laxton die unterschiedlichen Farbgebungen verschiedener Filmmaterialen simuliert – analoger Materialien und Emulsionen (und dabei ein Hohelied auf die Firma Kodak gesungen) -, um jedem der Teile eine unterschiedliche Anmutung zu geben. Und er hat seine Darsteller anders geschminkt. Nämlich nicht gepudert, was schwarze Haut matt und tot aussehen lässt, sondern geölt, damit sie so wundervoll glänzen, wie Sie es gleich sehen werden.
Im Mondlicht schimmern alle Jungen blau. Ein Sprichwort, auf das sich der Titel bezieht. Und so ist es tatsächlich. Es ist ein Traumlicht für eine Welt, die wir so im Kino noch nicht gesehen haben. Eine Welt, in der Geschichten stattfinden, die wir bisher viel zu selten gehört und gesehen haben und die dennoch von etwas erzählen, das uns nah ist - in der Sehnsucht und dem Schmerz des Erwachsenwerdens. Es heißt ja immer, diese Dinge seien universell – aber im Kino sehen sie meistens so aus, als stießen sie vor allem heterosexuellen Weißen zu. In „Moonlight“ gibt es keine Weißen.
Wenn ich es richtig sehe, stehen der Film-Jury der Evangelischen Akademie gewisse Veränderungen bevor. Dazu wünsche ich Ihnen, wenn ich mir das an dieser Stelle erlauben darf, eine glückliche Hand. Wenn ich als Filmkritikerin - als völlig säkulare Kritikerin, muss ich hinzufügen - auf die Entscheidungen dieser Jury über die Jahre hinweg schaue, stelle ich natürlich fest, welch außerordentliches kinematographische Gespür hier am Werk war. Ich nutze also diese Gelegenheit, Ihnen zu dieser so kompetenten Jury zu gratulieren, die auch in diesem Jahr wieder den richtigen Film – sage ich – ausgezeichnet hat.
„Moonlight“ – für mich ist das einer der seltenen Filme, den ich als eine andere verlassen habe. Ein Film, zu dem es ein Vorher und ein Nachher gibt. Sie werden sehen. Ich hoffe, Ihnen geht das auch so. Ich wünsche es Ihnen.